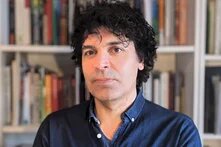Dossier
Soziale Resilienz
Soziale Resilienz ist in der politischen Bildungsarbeit wichtig, weil sie stärkt, was unsere Demokratie im Innersten zusammenhält: Vertrauen, Zusammenhalt und die Fähigkeit, mit Krisen solidarisch umzugehen. In einer Zeit gesellschaftlicher Spannungen und Unsicherheiten braucht es Räume, in denen Menschen lernen, Konflikte auszuhalten, Perspektiven zu wechseln und gemeinsam handlungsfähig zu bleiben.
Was ist eigentlich Soziale Resilienz?
Soziale Resilienz bezieht sich auf die Fähigkeit von Einzelpersonen, Gemeinschaften und Gesellschaften, sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Schocks und Belastungen standzuhalten und sich davon zu erholen. Dazu gehört die Fähigkeit, sich anzupassen und aus diesen Herausforderungen zu lernen sowie das soziale und wirtschaftliche Wohlergehen zu erhalten oder zu verbessern. Auch die Kultur kann dabei eine große Rolle spielen – gemeinsame Werte, Sprache, Bräuche und Gesellschaftsformen können den Menschen helfen, Widrigkeiten zu überwinden.
Um soziale Resilienz zu verstehen, werden nach aktuellem wissenschaftlichen Stand drei Dimensionen unterschieden:
-
Bewältigungskapazitäten: Reaktive Maßnahmen zur unmittelbaren Krisenbewältigung mithilfe vorhandener Ressourcen. Ziel ist es, das Wohlbefinden nach einem Ereignis schnell wiederherzustellen.
-
Anpassungskapazitäten: Proaktive Strategien, die auf Lernen, Vorsorge und schrittweise Veränderungen abzielen, um langfristig besser auf Risiken vorbereitet zu sein.
-
Transformative Kapazitäten: Die Fähigkeit, Ressourcen und Unterstützung aus dem weiteren sozialen und politischen Umfeld zu mobilisieren, an Entscheidungen mitzuwirken und Institutionen zu gestalten, um gesellschaftliche Widerstandsfähigkeit zu stärken.

Man sagt immer so leichthin Kultur ist der Kit der Gesellschaft. Das ist aber nicht nur ein Spruch, sondern wir wissen, dass verschiedene Arten kulturell miteinander umzugehen, Kultur zu teilen, Kultur miteinander zu produzieren, dafür sorgt, dass Menschen glücklich sind und dass es in einer Gesellschaft mehr Wir als Ich gibt.Annette Wiese-Krukowska
Interview mit Davide Brocchi
Als freiberuflicher Soziologe erforscht Davide Brocchi gesellschaftliche Transformationsprozesse in Theorie und Praxis mit Fokus auf soziale und kulturelle Nachhaltigkeit.
Soziale Resilienz in unseren Projekten
Bei unserem Konvent 2025 haben wir uns die Frage gestellt: Soziale Resilienz – Was hält uns als Gesellschaft zusammen? Dabei haben wir gemeinsam mit Expert*innen und unseren Projektteams ausgearbeitet, wo soziale Resilienz in unseren Projekten auftaucht und bedeutsam ist.
Themensetzungen unserer Projekte zu "Soziale Resilienz – Was hält uns als Gesellschaft zusammen?"
- Cultural Pearls: Neue Allianzen und Bündnisse für soziale Resilienz mit Davide Brocchi
- Liveability: Das Liveability Projekt - Wege zu lebenswerten Städten mit Anna Emil & Insa Olshausen
- Demokratietage: Schule bereitet den Weg für eine resiliente Gesellschaft von heute und morgen mit Keniya Kilicikan
- DLC: SEE-digital & Data for All: Resilienz im digitalen Wandel mit Claudia Obermeier
- Kulturwochen: Soziale Resilienz und Widerstandskraft von Afghanischen Frauen mit Shamsia Azarmehr
- Images of – Lateinamerika: Klimaresilienz – kritische Betrachtung und alternative Konzepte mit Dr. Libertad Chavez-Rodriguez
- Internationale Aktionswochen: Erneuerbare Energien als soziale Energien mit Martin Kastranek und Miriam Zweng
- Zukunftsmobil: Ästhetik, Resonanz und Soziale Resilienz mit Anja Nitz
- AG Diversity: Resilienz, Diversität, Empowerment - Modebegriffe ohne Inhalt? mit der AG Diversity
- Creative Circular Cities: Kreislaufgesellschaft – nachhaltige Lebensweise & nachbarschaftliche Vernetzung mit Kirsten Müller & Fridtjof Stechmann
- Ocean Summit & Ocean Youngsters: Gesellschaftliche Resilienz im Kontext von Klimawandel und Meereskrise mit Prof. Dr. Silja Klepp
- Bewirk & REC LV: Welche Rolle können Bürgerenergie und Energiegemeinschaften für die Stärkung sozialer Resilienz spielen? mit Michael Krug & Maura Rafelt
Resilienz in der Bildung bedeutet mehr als Wissensvermittlung – sie fördert emotionale Stärke, soziale Verantwortung und den Umgang mit Unsicherheiten.Aus dem Projekt Demokratietage
Best Practice & Work in Progress
Einige Beispiele zeigen, wie man es richtig macht, andere befinden sich noch auf dem Weg dorthin. Hier haben kulturelle oder gesellschaftliche Ideen und Konzepte entweder schon zur Stärkung der sozialen Resilienz beigetragen oder planen es in Zukunft.
Das Projekt Liveability führt an sechs verschiedenen Standorten Pilotprojekte durch. Die Pilotprojekte befassen sich alle mit der Schaffung sogenannter Dritter Orte. Der Dritte Ort ist der man sich neben dem Ersten Ort (Zuhause) und dem Zweiten Ort (Arbeitsstelle) aufhält – das kann also ein Café, ein Marktplatz oder eine Bibliothek sein. Die Schaffung 3. Orte soll die ausgewählten Städte lebenswerter machen und damit gleichzeitig auch die soziale Resilienz stärken. Folgende Pilotprojekte gibt es:

Cultural Planning
Cultural Planning ist ein methodischer Ansatz zur Stadt- und Regionalentwicklung, der Kultur als zentrales Werkzeug nutzt, um soziale, wirtschaftliche und räumliche Veränderungen anzustoßen. Sie wurde vor allem durch den britischen Kulturwissenschaftler Charles Landry bekannt gemacht.
Wir haben in verschiedenen Projekten erfolgrreich mit der Methode gearbeitet und tolle Ergebnisse erzielt.