Im vierten und letzten Teil des Interviews mit dem Soziologen Davide Brocchi erfahren wir mehr über gesellschaftliche Transformationsprozesse. Die vorhergehenden Teile befassen sich mit Hintergründen seines Buchs "By Disaster or by Design? Transformative Kulturpolitik", mit sozialer Resilienz sowie mit dem nachhaltigen Kulturwandel.
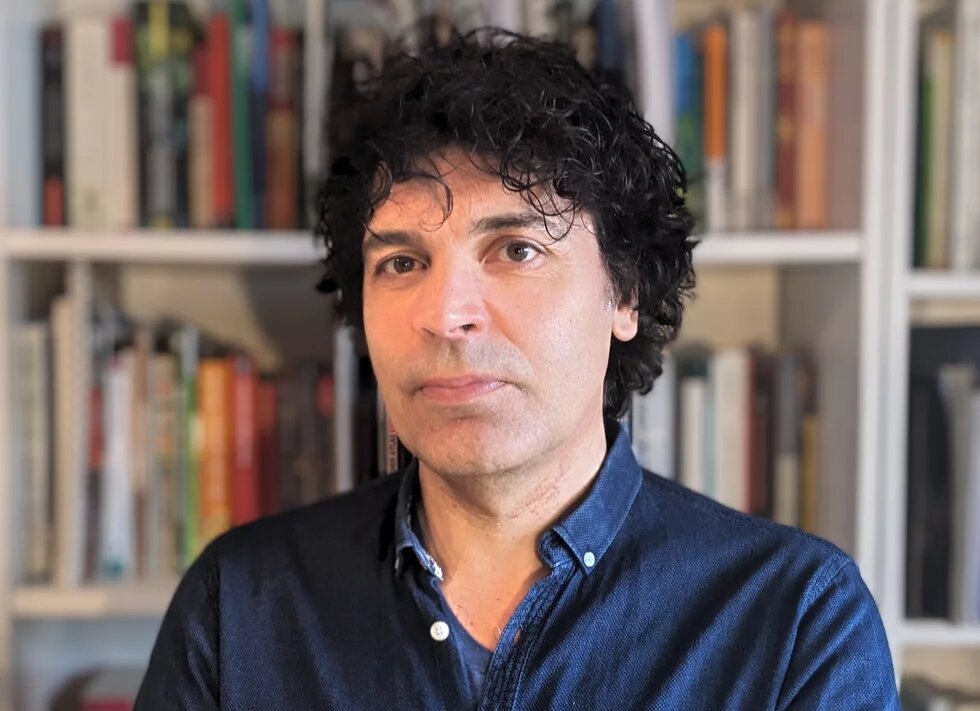
Welche konkreten Beispiele kennen Sie, bei denen die nachhaltige Transformation im lokalen Maßstab stattfinden kann?
Nach der Finanzkrise 2008 und dem Scheitern der UN-Klimakonferenz 2009 in Kopenhagen verlor sich die Illusion, dass eine Lösung für unsere globalen Probleme vom Markt oder von Regierungen kommen könnte. Einige Menschen kamen so zu der Erkenntnis, dass wir uns selbst zur Transformation ermächtigen müssen. Die Occupy-Wall-Street-Bewegung wollte damals die Wirtschaft demokratisieren und die Märkte wieder in die Gesellschaft einbetten. Die Transition-Town-Bewegung verbreitete sich international.
In Köln hatte ich 2011 die Idee eines neuen jährlichen Rituals zur Transformation von Städten: den Tag des guten Lebens. Wie würde ein Stadtteil aussehen, wenn er einen Tag lang von seinen Bewohnerinnen und Bewohnern selbst regiert würde? Eine breite lokale Bewegung (Agora Köln) aus Umweltinitiativen, Kirchen, Schulen, Theatern, sozialen Institutionen, Unternehmen usw. entstand, um diese Idee voranzutreiben und umzusetzen. Seit 2013 findet der Tag des guten Lebens einmal im Jahr in verschiedenen Stadtteilen Kölns statt. Rund 20–30 Straßen werden dabei zu einer Agora der gelebten Demokratie umgewandelt, indem sie von Autos und kommerziellen Aktivitäten befreit werden. Verkaufen und Kaufen sind in öffentlichen Räumen an diesem Tag nicht erlaubt, nur Teilen und Schenken sind gestattet. So wird die nicht-monetäre Ökonomie, die jeder von uns aus der eigenen Familie und dem Freundeskreis kennt, in der ganzen Nachbarschaft praktiziert. Als Währung dient an diesem Tag Vertrauen statt Euro.
Kann ein einziger Tag genügen, um eine Stadt nachhaltig zu verändern?
In der Transformation ist der Weg das eigentliche Ziel – so auch beim Tag des guten Lebens. Der Prozess beginnt ein Jahr im Voraus, indem in einem Stadtteil neue Allianzen gebildet werden. Als Hauptmedium der Transformation dient dabei das persönliche Gespräch, wobei die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren vor Ort als Partner gewonnen und miteinander vernetzt werden. Es geht nicht darum, die Menschen vor Ort zu missionieren, sondern darum, ihre tiefen Bedürfnisse und Sehnsüchte zum kollektiven Regierungsprogramm zu machen – unter dem Titel „Gutes Leben“.
Das gute Leben will gemeinsam ausgehandelt werden, denn die Autofahrer hätten gerne mehr Parkplätze auf der Straße, die Umweltaktivisten weniger, ältere Menschen mehr Ruhe und die Kinder am liebsten spielen: Wie kommen Menschen mit verschiedenen Interessen zu einer gemeinsamen Vorstellung der Nutzung der Straße? Jede Nachbarschaft kann sich als erweiterte Wohngemeinschaft verstehen und entsprechend Entscheidungen treffen. In einer vertrauten Atmosphäre funktioniert die Demokratie leichter. Ebenso wichtig ist die Augenhöhe – der soziale Ausgleich dort, wo sonst Ungleichheiten bestehen.
Beim Tag des guten Lebens bekommen die Menschen die Möglichkeit, ihr gemeinsam entwickeltes politisches Programm in die Praxis umzusetzen und ihren eigenen Stadtteil zu regieren. Dabei können sie kollektive Selbstwirksamkeit erfahren und die Transformation mit allen Sinnen erleben. Was an einem Tag möglich ist, kann das ganze Jahr lang möglich sein. Die Atmosphäre, die über einen solchen Tag im Stadtteil entsteht, entfaltet Wirkung über den Tag hinaus. So werden nicht nur Werkzeuge miteinander geteilt, sondern auch Solidarität und Verantwortung. Nur wenn sich diese Nachbarschaftsarbeit als Demokratiearbeit versteht, haben solche Initiativen eine wirklich transformative statt bloß kompensatorische Wirkung. Dieselbe Nachbarschaft, die das Programm des Tags des guten Lebens gestaltet, soll dann auch die Mobilitätspolitik, die Wohnpolitik, die Umweltpolitik usw. im eigenen Stadtteil mitbestimmen.
Durch diese Erfahrung, die ich in weiteren Städten fortführen durfte – zum Beispiel in Berlin und Bremen – bin ich dazu gekommen, eine Strategie der Transformation aus dem Lokalen heraus zu entwickeln, die auf drei Zutaten basiert:
- Begegnungsräume als Gemeingut: die Agora, das nachbarschaftliche Wohnzimmer… Selbst Urban-Gardening-Projekte, Kirchen, Universitäten, Schulen, soziokulturelle Zentren und Theater können als solche dienen, wenn man bereit ist, ein Stück Ownership (den Schlüssel) abzugeben.
- Neuartige Rituale, die ko-kreativ entwickelt, nicht kommerziell sind und in umgedeuteten und umfunktionierten Räumen stattfinden.
- Bewegungen und neue Allianzen, denn ohne die Agora Köln hätten Politik und Verwaltung einen solchen politischen Gestaltungsraum weder zugelassen noch unterstützt. Es braucht Allianzen zwischen Ökologie, Ökonomie, Sozialem und Kultur; zwischen Nachbarschaften und sozialen Bewegungen, zwischen Bürgern und Kommunalinstitutionen, Stadt und Land…Bündnisse sind wichtig, um ein Stück gutes Leben jeden Tag möglich zu machen und die Rahmenbedingungen entsprechend zu ändern.
Wie kann jede*r von uns zur nachhaltigen Transformation beitragen?
Die Gesellschaft und die Kultur, die wir verändern wollen, stecken auch in uns selbst. Transformation beginnt nicht irgendwo da draußen, sondern bei uns selbst – reflexiv. Das bedeutet jedoch nicht, dass Nachhaltigkeit durch individuelle „Selbstoptimierung“ erreicht werden kann. Im Gegenteil: Nachhaltigkeit hat nur dann eine Chance, wenn sie politisiert und als gemeinsame Aufgabe verstanden wird. Der erste Schritt ist also die Kooperation. In jedem Theater, jeder Schule, jedem Unternehmen und jeder Nachbarschaft … stellen sich Fragen, die die ganze Gesellschaft betreffen: Wer trifft hier Entscheidungen für wen? Welche Erziehung und welche Arbeit sind wirklich sinnvoll? Leben wir auf Kosten anderer? Wir können also in unserer unmittelbaren Umgebung mit der Transformation beginnen. Ob es um Arbeits- und Wohnverhältnisse, Klima- oder Kulturpolitik geht – viele dieser Themen lassen sich als Fragen des Zusammenlebens behandeln. Probleme auf der Sachebene sind oft Ausdruck von Problemen auf der Beziehungsebene. Nachhaltigkeit setzt daher meist eine Veränderung von Beziehungen voraus – und Beziehungen haben mindestens zwei Seiten. Man kann die Benachteiligung der einen nicht überwinden, ohne die Privilegien der anderen infrage zu stellen. Es braucht also eine Entwicklungspolitik nicht nur für die Benachteiligten, sondern auch für die Privilegierten.
Ein gutes Leben ist nicht status-, sondern beziehungsorientiert. Es geht nicht um Massenkonsum, sondern um Resonanz. Die Glücksforschung zeigt: Soziale Beziehungen und Zusammenhalt sind die wichtigsten Faktoren für unser Wohlbefinden. Jeder Mensch ist Teil ökologischer und sozialer Kontexte – und kann darin viel bewirken. Wenn der Flügelschlag eines Schmetterlings in Indien einen Hurrikan in den USA auslösen kann (Schmetterlingseffekt), dann kann auch eine kleine menschliche Handlung große Wirkung entfalten. Manchmal ist Nicht-Handeln sogar nachhaltiger als Handeln: Nicht zu fliegen ist nachhaltiger als zu fliegen, Bewahrung oft wirksamer als Gestaltung. Gandhi zeigte, wie mächtige Systeme durch zivilen Ungehorsam ins Wanken geraten können. Nachhaltigkeit bedeutet also auch, Nein sagen zu lernen – und sich der Komplizenschaft zu entziehen.
Welche Rolle kann oder sollte die Heinrich-Böll-Stiftung in diesem Prozess spielen?
Zunächst sollten wir uns an Heinrich Böll erinnern, dessen Erbe auch heute noch von großer Bedeutung ist. Er konnte Machtmechanismen auf sehr feinsinnige Weise verstehen und analysieren und hatte einen starken Antrieb, Arroganz und Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Böll war ein kritisch denkender Intellektueller. Heute wäre er ebenfalls „unbequem“ – vermutlich sogar für seine eigene Partei, die Grünen in Deutschland.
Die westliche Gesellschaft neigt noch immer dazu, die Welt von oben zu betrachten und sich selbst als „Hochkultur“ und „Wertegemeinschaft“ zu verstehen. In Wirklichkeit braucht sie jedoch weiterhin eine kritische Selbstreflexion. Ein wichtiger Indikator für die wahre Freiheit einer Gesellschaft liegt im Umgang mit kritischen Positionen und Alternativen zur „Monokultur“. Die Heinrich-Böll-Stiftung sollte diese Freiheit unterstützen – in der Forschung, in den Medien, in der Kunst und in der Zivilgesellschaft.
Immer noch werden folgenschwere politische Entscheidungen so legitimiert, als gäbe es keine Alternative. Leider sind es vor allem rechtspopulistische Bewegungen, die sich den notwendigen Raum für Alternativen zu eigen gemacht – und ihn dadurch entwertet haben. Gerade die „Alternative für Deutschland“ (AfD) ist jedoch kein Gegner, sondern ein Produkt des bisherigen Systems. Ihre Ideologie verbindet den Staat als Ordnungshüter (Leviathan) mit Wettbewerb und „Homo oeconomicus“. Dass die AfD von einem neoliberalen Professor wie Bernd Lucke gegründet wurde, verdeutlicht, dass Rechtsradikalismus und Kapitalismus schon immer einen gemeinsamen Feind hatten: eine starke Demokratie und eine gerechte Gesellschaft. Wenn wir den Kampf gegen diese Kräfte gewinnen wollen, reicht der Schutz einer unvollendeten Demokratie nicht aus. Wir sollten die Demokratie vielmehr weiterdenken, reformieren, stärken – und vor allem leben. Wir brauchen mehr direkte Demokratie, eine konsequente Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips, eine demokratische Kontrolle der Märkte und eine Demokratisierung der Europäischen Union. Da Parlamente die Gesellschaft immer weniger abbilden und oft lediglich ein Anhängsel der Regierungen sind, brauchen wir neue und zusätzliche Orte demokratischer Teilhabe sowie starke Bewegungen, die sie tragen. Wenn die Privatisierungswelle der letzten Jahrzehnte die soziale Kohäsion in der Gesellschaft geschwächt hat, dann braucht ihre Stärkung eine Resozialisierung der Infrastrukturen – und das bedeutet auch: mehr Agoras, Gemeingüter, Genossenschaften, soziokulturelle Zentren, solidarische Landwirtschaft usw.
Ich fürchte, dass die derzeitige verschärfte Migrationspolitik in Verbindung mit einer zunehmenden Militarisierung eine Regression für unsere Gesellschaft darstellt, während zentrale Zukunftsthemen aus dem Blick geraten. Böll war eine starke Stimme der Friedensbewegung. Gerade ein Land mit der Geschichte Deutschlands sollte heute als diplomatischer Brückenbauer auftreten – und nicht erneut zur „stärksten Armee Europas“ (Friedrich Merz) werden wollen. Von der Kolonisierung bis heute hat sich der Westen weltweit nicht unbedingt beliebt gemacht. Sein Verhalten auf anderen Kontinenten entsprach selten dem Anspruch einer echten „Wertegemeinschaft“. Deshalb braucht es eine Böll-Stiftung als Bühne für den Dialog auf Augenhöhe mit den vermeintlich „Fremden“ und für einen Perspektivenwechsel: Wie blickt der Globale Süden auf uns – und warum? Was können wir von anderen lernen? Wie können wir den künftigen Generationen und der Natur Gehör verschaffen?
Die weiteren Interviews finden sich unten.
Anmerkung der Redaktion: Das Interview wurde auf englisch geführt und von unserer Redaktion übersetzt.


