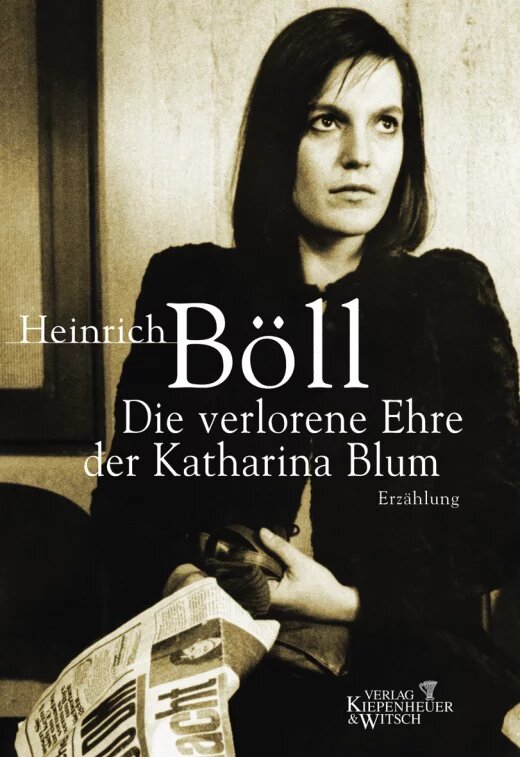
Auf zwei Veranstaltungen haben wir Anfang Juli das 50-jährige Filmjubiläum von Bölls "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" gefeiert. Zu diesem Anlass haben wir uns damit auseinandergesetzt, wie die Erzählung, Bölls persönliches Leben und die generellen Ansprüche eines demokratischen Journalismus miteinander zusammenhängen.

Die verlorene Ehre der Katharina Blum – ein Beispiel für die Bedeutung von demokratischem Journalismus
In Zeiten von Fake News, ungleichen Machtverhältnissen und Intransparenz kommt dem demokratischen Journalismus eine besonders wichtige Rolle zu. Durch soziale Medien und das Internet im Allgemeinen verschwimmt die klare Trennlinie zwischen verantwortungsvoll recherchiertem Journalismus, hetzerischen, falschen Schlagzeilen und privat produzierten Gerüchten. Heute sind es nicht mehr unbedingt Journalist*innen, die eine Nachricht in die Welt setzen, sondern vielmehr Privatpersonen, selbsternannte Aufdecker*innen oder womöglich sogar Verschwörungstheoretiker*innen.
Ähnlich, wenn auch in anderer Form, war es als 1974 Heinrich Bölls Erzählung „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ im Spiegel erschien. Zwar hatten Journalist*innen vor 51 Jahren noch weitgehend die Nachrichtenhoheit, doch Verunglimpfung und Hetze existierten damals wie heute. In dem Werk wird das Leben der Protagonistin Katharina Blum durch Falschdarstellungen in der Presse und unverantwortliche Polizeiarbeit zerstört.
Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Verfilmung durch Volker Schlöndorff, hat die Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein Anfang Juli zwei Veranstaltungen in Kiel organisiert. Zunächst wurde der Film mit Angela Winkler und Mario Adorf in den Hauptrollen gezeigt. Am nächsten Tag las die Schauspielerin Ellen Dorn dann Ausschnitte aus der Erzählung. Maria Birger vom Böll-Archiv in Köln gab spannende Hintergrundinformationen. Schließlich fand eine Gesprächsrunde mit Presseakteur*innen zur Zukunft des demokratischen Journalismus statt.
Demokratischer Journalismus – Anspruch und Herausforderungen
Doch was ist eigentlich demokratischer Journalismus? Der etwas sperrige Begriff umfasst viele Teilbereiche. Zunächst einmal sollte demokratischer Journalismus die Prinzipien einer demokratischen Gesellschaft stärken und sie mit- und weitertragen. Grundlage ist dabei eine sachliche, gut recherchierte Berichterstattung, die nicht auf Effekthascherei oder große Schlagzeilen aus ist. Er ist unabhängig von politischen, wirtschaftlichen oder ideologischen Interessen, transparent und zeigt sich verantwortungsvoll. Seine Perspektive sollte niemals einseitig sein, sondern vielmehr die multiplen Sichtweisen der Gesellschaft abbilden. Er sollte ebenso für deren Kritik offen sein und sich mit ihr auseinandersetzen. Zudem sind der Schutz des Persönlichkeitsrechts und eine menschenwürdige Darstellung von zentraler Bedeutung.
Die Ansprüche des demokratischen Journalismus sind auf dem Papier klar, aber welche Herausforderungen können sich bei der Berichterstattung ergeben? Mit welchen Widersprüchen sehen sich Journalist*innen konfrontiert? Ein Widerspruch kann beispielsweise im Konflikt zwischen dem Recht auf Pressefreiheit und dem Schutz des Persönlichkeitsrechts bestehen. Hier stellt sich die Frage: Wo hört Pressefreiheit auf und wo beginnt das Persönlichkeitsrecht? Selten ist die Grenze eindeutig. Oft müssen Journalist*innen abwägen, welches das moralisch richtige Vorgehen ist. Es gibt sicherlich Fälle, in denen die Pressefreiheit über dem Schutz des Persönlichkeitsrechts stehen kann, beispielsweise, wenn die Bedeutung der Nachricht für die Gesamtgesellschaft größer ist als der Schutz der Persönlichkeit. Allerdings ist das selten der Fall.
So argumentierten viele Medien im „Fall Kachelmann“ 2010 das Informationsinteresse der Öffentlichkeit sei höher anzusetzen wäre als das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Viele Medien berichteten von den Vergewaltigungsvorwürfen gegen den TV-Moderator und stellten die Vorwürfe teilweise sogar als absolut dar. Jörg Kachelmann wurde angeklagt und freigesprochen, da sich die Vorwürfe nicht beweisen ließen – er war also unschuldig, sein Ruf ist allerdings bis heute beschädigt. Letztendlich rechtfertigte das öffentliche Interesse an der Person Jörg Kachelmanns nicht die Missachtung seines Persönlichkeitsrechts und der Unschuldsvermutung. Eine Erkenntnis, die bei vielen zu spät kam.
Heinrich Bölls persönliche Erfahrung mit der Presse
Ähnlich wie Jörg Kachelmann sah sich Heinrich Böll jahrelang einer Kampagne ausgesetzt. Der Vorwurf war ein anderer: Dem Autor wurde Unterstützung der Roten Armee Fraktion (kurz: RAF) vorgeworfen. Die Springer-Medien, insbesondere die BILD-Zeitung, berichteten während der Zeit der terroristischen Bedrohung durch die RAF immer wieder emotionalisierend, aggressiv und ohne Rücksicht auf Persönlichkeitsrechte über die Terrorgruppe. Verschiedene Aussagen Heinrich Bölls, die sich unter anderem allein darauf bezogen, dass allen Menschen ein unabhängiger Gerichtsprozess zusteht, wurden von der Springer-Presse verdreht und im falschen Kontext wiedergegeben. So wurde Böll als RAF-Sympathisanten dargestellt.
Die Achtung vor der Menschenwürde darf auch durch das Recht auf Pressefreiheit nicht aufgehoben werden. (Heinrich Böll im Vorwort von "Die verlorene Ehre der Katharina Blum")
Über die Jahre hinweg wiederholte sich diese Form der Berichterstattung. Sie wurde von anderen Medien reproduziert. Auch das Staatsorgan in Form der Polizei, ließ in den damals aufgeheizten Zeiten, das Haus der Familie Böll sowie die Wohnungen der drei Söhne mehrmals durchsuchen, um Beweise für Verbindungen zur Terrorgruppe zu finden. Sie fanden nichts. Weil die Behauptungen schlichtweg falsch waren. Weil Heinrich Böll kein Sympathisant der RAF war. Ihm ging es – besonders vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg – darum, dass jeder Mensch die gleichen im Grundgesetz verankerten Rechte hat.
Bölls Reaktion auf seine eigene Diffamierung
Als Reaktion auf seine Erfahrungen mit der Presse veröffentlichte Heinrich Böll 1974 die Erzählung „Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder: Wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann“, in der die Protagonistin von einer Zeitung namens DIE ZEITUNG verunglimpft wird. Böll schrieb als Vorbemerkung: „Personen und Handlung dieser Erzählung sind frei erfunden. Sollten sich bei der Schilderung gewisser journalistischer Praktiken Ähnlichkeiten mit den Praktiken der Bild-Zeitung ergeben haben, so sind diese Ähnlichkeiten weder beabsichtigt noch zufällig, sondern unvermeidlich.“
Böll macht also keinen Hehl daraus, dass die fiktive DIE ZEITUNG in Wirklichkeit die BILD ist. Betrachtet man den gesamten Titel wird deutlich, worauf die Erzählung abzielt. Durch die aggressive Berichterstattung der ZEITUNG geht der Fall der Katharina Blum durch die Presse. Auf einer Party hatte sie einen mutmaßlichen Straftäter kennengelernt und die Nacht mit ihm verbracht. Sie verhilft ihm zur Flucht und wird am nächsten Morgen verhaftet. Ihr Fall wird von der Boulevardzeitung ausgeschlachtet, indem diese allerlei falsche Behauptungen aufstellt, mit unlauteren Mitteln Aussagen von Verwandt- und Bekanntschaft einholt und diese veröffentlicht. Innerhalb weniger Tage ist Katharina Blums Leben zerstört und nimmt einen tragischen Verlauf.
Heinrich Böll zeigt uns mit dieser Erzählung, wohin die Gewalt führen kann. Gewalt, die von unverantwortlich arbeitenden Medien ohne Rücksicht auf Verluste ausgeübt wird. Die Erzählung berichtet von seinem eigenen Leben, seinen (Gewalt-) Erfahrungen mit der Springer-Presse. Als Reaktion auf den großen Erfolg von „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“, streicht die WELT (ebenfalls Teil der Springer-Mediengruppe) die Veröffentlichung der Bestsellerlisten, da Bölls Werk dort auf Platz eins ist. Die Fronten sind verhärtet. Heinrich Böll wird keinem Medium der Springer-Mediengruppe je wieder ein Interview geben.
Katharina Blum: Aktuell damals wie heute
Bevor der Film von Volker Schlöndorff und Margarethe von Trotta gezeigt wurde, gab Maria Birger vom Böll-Archiv eine kurze Einführung samt Hintergrundinformationen. Die Einführung war eine hilfreiche Basis, um den Film in seiner Gänze zu erfassen. Das Publikum bestand zum größten Teil aus älteren Personen, die den Film bereits in den 70er- oder 80er-Jahren gesehen hatten. Es waren aber auch viele Jüngere anwesend, die den Film noch nie gesehen hatten. Das Stimmungsbild nach der Vorführung war eindeutig: Alle Zuschauer*innen waren von der Aktualität der Erzählung überrascht. Der Film ist immerhin 50 Jahre alt. Das merkt man zwar seiner Machart an – die Handlung ist viel langsamer erzählt – aber inhaltlich ist er heute genauso relevant wie 1975.
Am nächsten Abend veranschaulichte die szenische Lesung von Kammerschauspielerin Ellen Dorn die aussichtslose Lage von Katharina Blum noch einmal eindrücklich. In Rückblenden auf ihre Verhaftung schaut Ellen Dorn als Katharina Blum 25 Jahre später zurück. Sie denkt daran, wie die Polizei ihre Wohnung durchsuchte, wie sie vom Kommissar herabwürdigend behandelt wurde, wie der Journalist Werner Tötges sie in der ZEITUNG diffamierte, wie man ihr Verbindungen zu Kriminellen oder zahlreiche Affären andichtete und wie sie binnen weniger Tage ganz Köln als „Terrorbraut“ oder „Mörderverführerin“ kannte.
Moderator Henning Fietze vom OKSH stellte den Panelgäst*innen die Frage: „Kann so etwas, wie damals Katharina Blum, heute noch passieren?“ Auch die Gesprächsteilnehmer*innen sind sich einig: eindeutiges Ja. Christiane Hampe von R.SH und Kristian Blasel von den Kieler Nachrichten vertreten als Medienmacher*innen die These, dass sich die Gefahr, vor allem durch Social Media und den rasanten Fortschritt der künstlichen Intelligenz, verstärkt hat. Die klassischen Medien haben nicht mehr die Oberhand. Mittlerweile kann jede*r über das Internet seine Meinung äußern oder persönliche Kampagnen gegen Personen starten. Dennoch, sagen beide, haben Journalist*innen weiterhin die Aufgabe, abzuwägen und moralisch sowie ethisch zu handeln – auch wenn sie in starker Konkurrenz zu den sozialen Medien stehen und sich durch die Vielzahl der in den letzten 20 Jahren entstandenen Kanäle in ihrer Existenz bedroht sehen. Heute wie damals gibt es aber bestimmte Medien, die immer noch zu unlauteren Methoden greifen und falsche oder reißerische Schlagzeilen verbreiten. Ihre Wirkmacht ist jedoch nicht mehr die von vor 50 Jahren.
Die Relevanz der klassischen Medien, wie einer Lokalzeitung, rückt in dem Gespräch in den Fokus. Philipp Dudek von „Im Kontext“ berät unter anderem Zeitungen, wie sie in heutigen Zeiten relevant bleiben und ihre Strategie anpassen können. Viele Lokalzeitungen haben Probleme, neue Abonnent*innen zu gewinnen. Es herrscht die Meinung, dass „die jungen Leute“ heute keine Zeitung mehr lesen und nicht mehr bereit sind, dafür Geld zu investieren. Für Philipp Dudek ist das Alter jedoch keine Zielgruppe. Seiner Meinung nach müssen komplexere Strategien entwickelt werden, als nur die jüngere Generation abzuholen. Auch in deutschen Medienhäusern geht die Digitalisierung und Selbsterneuerung nur langsam voran.
Laut Doris Lorenz, der geschäftsführenden Vorständin unserer Landesstiftung, besteht die Aufgabe der politischen Bildungsarbeit vor allem darin, über den demokratischen Journalismus aufzuklären. Als Stiftung können wir aufzeigen, welche Merkmale seriösen Journalismus auszeichnen und welche Warnzeichen auf Fake News oder auch populistische Inhalte hindeuten können. Mithilfe verschiedener Bildungsmaterialien sowie Seminaren und Projekte können wir Menschen jeden Alters an den bewussten, hinterfragenden Konsum von Medien aller Art heranführen.
Was können wir tun?
Die Frage stellt sich also allgemein: Was können und müssen wir als Gesellschaft tun, um demokratischen Journalismus zu sichern? Zunächst einmal können wir die Medien stärken, die seriösen, gewissenhaft recherchierten Journalismus betreiben, sei es durch unseren Konsum, durch finanzielle Unterstützung in Form von Abonnements oder durch die Weiterverbreitung und das Teilen ihrer Beiträge.
Grundsätzlich gilt es immer wieder auf die Wichtigkeit kritischer Medienkompetenz und einer solidarischen Öffentlichkeit aufmerksam zu machen und den Menschen das nötige Handwerkszeug dafür an die Hand zu geben oder anzubieten. Gerade heute wird es durch das Internet und KI immer schwieriger, falsche Inhalte zu entschlüsseln. Wir alle kennen das: Wir sehen eine Schlagzeile und klicken darauf, weil wir wissen wollen, was dahintersteckt. Oft ist das eine einfache Clickbait-Strategie. Diesem Impuls zu widerstehen, kann auch eine Möglichkeit sein.
Im Sinne Heinrich Bölls ist es wohl am wichtigsten, kritisch zu hinterfragen und sich vor Augen zu führen, dass mit Schlagzeilen u. a. Persönlichkeitsrechte verletzt werden können. Oft hilft ein zweiter Blick, eine weitere Überlegung. Zum Glück gibt es in Deutschland noch genügend Medien, denen wir vertrauen können und die einen ordentlichen Journalismus nach ethischem Kodex betreiben. In vielen anderen europäischen Ländern sehen diese sich bereits bedroht. Wir müssen uns also dafür entscheiden, die neutrale, recherchierte Berichterstattung der effekthaschenden vorzuziehen. Wie Heinrich Böll schon sagte:
Pressefreiheit ist ein hohes Gut – aber sie entbindet nicht von der Verpflichtung zur Wahrheit.









