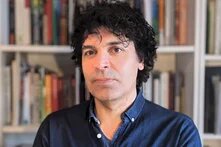Im zweiten von vier Teilen des Interviews mit dem Soziologen Davide Brocchi erfahren wir mehr zu seinem Verständnis von sozialer Resilienz. Die weiteren Interviewteile beschäftigen sich mit den Hintergründen seines Buchs "By Disaster or by Design? Transformative Kulturpolitik", die Frage des Kulturwandels sowie der Transformation.
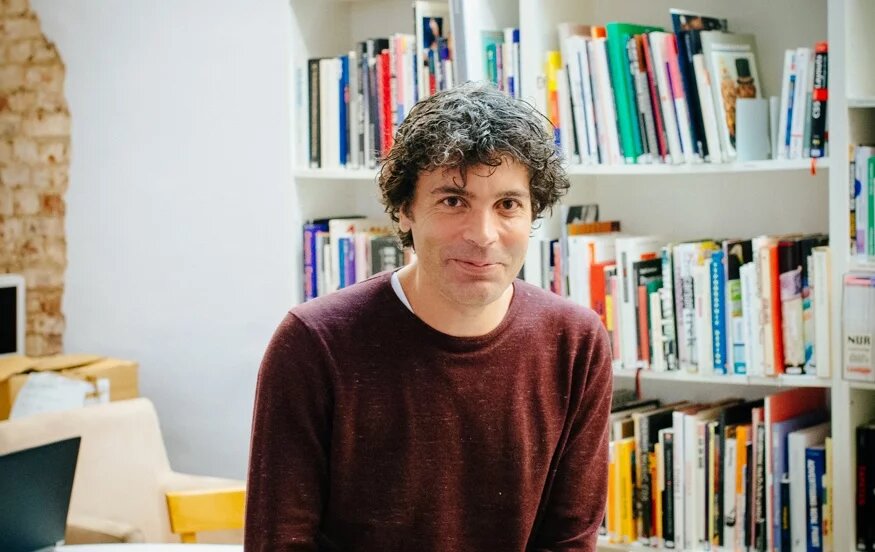
Was verstehen Sie unter sozialer Resilienz?
Der Begriff der Resilienz stammt ursprünglich aus der Medizin und Psychologie. Menschen reagieren nicht immer gleich auf Krankheiten oder Traumata: Was bei dem einen zum Tod führt, stärkt bei einem anderen die Antikörper. Das bedeutet, dass manche Menschen verletzlicher und andere widerstandsfähiger sind. Dieser Begriff wurde auf ökologische und soziale Systeme übertragen.
Bei ökologischen und sozialen Systemen ist eine präventive Resilienz wichtiger als eine reaktive: Dies gilt sowohl für den Klimawandel als auch für Finanzkrisen und Kriege. Die Ursachen von Krisen zu behandeln, ist nachhaltiger, als nur die Symptome zu lindern. Wenn der Status quo selbst die Ursache für Krisen ist, dann braucht die Resilienz nicht seinen Schutz, sondern seine Veränderung.
Vielfalt macht ökologische und soziale Systeme in Krisenzeiten agiler. Wälder mit hoher Biodiversität sind widerstandsfähiger gegen den Klimawandel als Baum-Monokulturen. Städte mit Subkulturen und Nischen, in denen Alternativen gedeihen können, sind ebenfalls besser für die Zukunft gerüstet. Während eine plurale Wirtschaft resilienter ist, ist eine neoliberale Monokultur krisengefährdet, wie die Finanzkrise von 2008 gezeigt hat. Monokulturen, einschließlich mentaler, weisen eine erhöhte Vulnerabilität auf, weil sie dazu tendieren, die Ursachen von Problemen als Lösungen zu verpacken. Ein Beispiel dafür sind Wirtschaftswachstum und technologische Innovation: Diese werden immer noch als Allheilmittel betrachtet, obwohl sie viele Probleme verursacht haben.
Ein weiterer wichtiger Faktor der Resilienz ist Autonomie, also die Möglichkeit der Selbstorganisation. Polyzentrische Netzwerke sind in der Regel flexibler und widerstandsfähiger als zentralistische Organisationen. Das Gegenteil von Autonomie sind Abhängigkeiten. Eine Gesellschaft mit hohem Energie- und Ressourcenverbrauch ist in Anbetracht der planetaren Wachstumsgrenzen verletzlicher. Fahrradfreundliche Städte hingegen sind widerstandsfähiger gegen steigende Ölpreise und tragen weniger zum Klimawandel bei. Regionen mit einer Parallelwährung sind widerstandsfähiger gegenüber internationalen Finanzkrisen, weil ihre Wirtschaft auch dann weiter funktionieren kann, wenn Euro oder Dollar nicht fließen.
Soziale Resilienz hängt auch stark mit sozialer Kohäsion zusammen. Bäume sind widerstandsfähiger, wenn sie in der Nähe anderer Bäume wachsen und über ihre Wurzeln Netzwerke bilden können. Dasselbe gilt für Menschen: Sie sind Individuen und soziale Wesen zugleich. Soziale Netzwerke können Autonomie mit Bindung sowie Vielfalt mit Einheit verbinden. In schwierigen Zeiten sind sie fundamental für das Überleben von Individuen. So konnte Barcelona die Finanzkrise von 2008 leichter überwinden, weil dort die Nachbarschaften relativ stark sind. Menschen, die ihre Arbeit verloren hatten, begannen miteinander zu teilen und eine Tauschwirtschaft aufzubauen. Wenn soziale Kohäsion und Vertrauen Systeme widerstandsfähiger und flexibler machen, dann machen soziale Ungleichheit und Misstrauen sie anfälliger und rigider.
Welche Relevanz hat soziale Resilienz heute?
Heute stehen wir zwischen zwei großen Transformationen. Die dominante ist die kapitalistisch-industrielle Transformation, die vor einigen Jahrhunderten begann. Die neoliberale Globalisierung war ihr Höhepunkt und ist wahrscheinlich der Todesstoß für dieses Entwicklungsmodell. Dies hat die Resilienz geschwächt und die Verwundbarkeit erhöht. Die britische Premierministerin Margaret Thatcher, die gemeinsam mit dem US-Präsidenten Ronald Reagan in den 1980er-Jahren die neoliberale Wende einleitete, sagte 1987 in einem Interview: „Es gibt keine Gesellschaft, sondern nur Individuen.“ Wenn es aber keine Gesellschaft gibt, dann existieren nur private Probleme, die individuell gelöst werden müssen. In der neoliberalen Gesellschaft ist jeder für sich selbst verantwortlich – für den eigenen Erfolg oder für den eigenen Misserfolg. Diese Denkweise führte zum Abbau des Wohlfahrtsstaates und zu einem verbreiteten Gefühl der Unsicherheit. In den letzten Jahrzehnten lernten wir, miteinander zu konkurrieren, um einen der wenigen Plätze in der Sonne zu ergattern. Bekanntlich legitimierte Margaret Thatcher ihre Politik vor allem mit dem Satz „there is no alternative“. Diese Rhetorik der Alternativlosigkeit fand nach ihr zahlreiche Nachahmerinnen und Nachahmer. Wenn es keine Alternative gibt, bleibt nur die Monokultur. Die Gesellschaft verkommt zu einer „Megamaschine“, und Politik zu einer „Verwaltung von Sachen“. Auf Störungen und Krisen wird mit einer Stabilitätsstrategie reagiert – durch Reparaturen, Optimierungen und die Verlagerung von Kosten. Der Fokus liegt auf der Funktionsfähigkeit der Maschine, während verdrängt wird, dass selbst eine perfekt funktionierende Maschine gegen die Wand fahren kann. Vor diesem Hintergrund braucht Nachhaltigkeit nicht besser funktionierende Menschen, sondern zunächst deren Emanzipation von der Megamaschine.
Welches Potenzial hat Kultur, um soziale Resilienz zu stärken?
Der Philosoph Jürgen Habermas würde kulturelle Resilienz mit „Lernfähigkeit“ übersetzen. Um gesellschaftliche Sackgassen zu vermeiden, sind individuelle und kollektive Lernmechanismen entscheidend. Anstatt in einer Maschine bloß zu funktionieren (Kybernetik erster Ordnung), benötigen wir die Vogelperspektive und die Fähigkeit zur Reflexion – also eine Kybernetik zweiter Ordnung –, um zu erkennen, dass wir uns in die völlig falsche Richtung bewegen. Die Natur hat im Laufe ihrer Entwicklung fünf große Krisen (Massenaussterben) überstanden – und hatte dabei keinen Masterplan. Die Evolution von Systemen beruht auf der Wechselwirkung eines „stützenden Beins“ mit einem „spielenden Bein“. Neben dem Funktionieren braucht die Gesellschaft unter anderem kulturelle Mutationen, um in einer dynamischen Umwelt bestehen zu können. Ohne Freiräume keine Evolution. Kunst und Kultur bieten einen wichtigen Raum für gesellschaftliche Selbstreflexion, für individuelle Lernprozesse – und für Mutationen.
Weil Ideologien nicht lernfähig sind, ändern sie sich oft nur infolge von Katastrophen oder Revolutionen. Wie hartnäckig die Wirtschaftsideologie ist, die unsere Gesellschaft dominiert, zeigte sich nach der Finanzkrise von 2008: Im VWL-Studium änderte sich kaum etwas – als hätte es die Krise gar nicht gegeben. Wer besonders von der gesellschaftlichen Entwicklung profitiert und die Kosten des eigenen Handelns externalisieren kann, ändert selten das eigene Weltbild. Diese Selbstreferenzialität mentaler Systeme ist eine Hauptquelle jener Wahrnehmungsblasen, die Krisen verschärfen und im Kollaps enden können. Wenn im deutschen Parlament 87 Prozent der Abgeordneten einen Hochschulabschluss haben, während diese Gruppe in der Bevölkerung eine Minderheit darstellt, birgt das die Gefahr einer Politik, die den Kontakt zu breiten Teilen der sozialen Realität verliert. Wenn inzwischen mehr als 60 % der Bevölkerung keiner Partei mehr zutraut, die großen Probleme unserer Zeit anzugehen, ist das ein Alarmzeichen für die Demokratie.
Je homogener eine Gruppe ist (nach dem Motto ‚Gleich und Gleich gesellt sich gern‘), desto weniger kann sie lernen. Viele Menschen leben heute in ihrem eigenen sozialen und mentalen Ghetto. Zwischen privilegierten und benachteiligten Quartieren gibt es im Alltag kaum Interaktion – obwohl sie zur selben Stadt gehören und sich Privilegien und Benachteiligung gegenseitig bedingen. In Städten trennen unsichtbare Mauern die sozialen Schichten; global hingegen materialisieren sich soziale Ungleichheiten zunehmend in festen Grenzmauern zwischen dem Globalen Norden und dem Globalen Süden. Diese Mauern schützen nicht nur unseren Wohlstand, sondern auch die Ursachen der wachsenden Unordnung da draußen, denn Massenkonsum ist ohne Ausbeutung nicht denkbar. Die Mauern versperren den Blick auf die wahren Kosten unserer Lebensweise und ersparen uns die direkte Auseinandersetzung mit ihren Opfern.
Kulturelle Arbeit – wie sie von der UNESCO verstanden wird: Bildung, Wissenschaft, Kunst und Medien – wird dort als Brücke benötigt, wo sonst sichtbare und unsichtbare Mauern vorherrschen. Wir brauchen Kultur als Bühne für Perspektivwechsel und den Dialog mit dem Fremden – im Sinne des „Theaters der Unterdrückten“ von Augusto Boal. Wie wäre es, wenn wir Partnerschaften und den Austausch zwischen reichen und armen Stadtteilen innerhalb derselben Stadt gezielt fördern würden?
Wenn soziale Kohäsion ein zentraler Faktor für Resilienz ist, spielt Kultur auch hier eine entscheidende Rolle. Für Émile Durkheim ist sie der Kitt der Gesellschaft – das integrative Bindemittel in einer arbeitsteiligen Welt. Während die Erziehung zum Homo oeconomicus Kohäsion schwächt, braucht ihre Stärkung eine Erziehung zum Homo solidaricus. Soziokulturelle Zentren und Urban-Gardening-Projekte sind Ausdruck einer solchen Kultur. Auch solche Infrastrukturen prägen unser Zusammenleben – und es braucht mehr davon. Wie wäre es, wenn in jeder Nachbarschaft Begegnungsorte als Gemeingut eingerichtet und selbstverwaltet würden? Partizipation setzt Institutionen und Einrichtungen voraus, die bereit sind, ein Stück Ownership – den „Schlüssel“ – abzugeben. Da sich Verwaltungen in Deutschland oft als Ordnungshüter statt als Ermöglicher verstehen, braucht es oft neue Allianzen und breite Bündnisse, um Spielwiesen für Alternativen entstehen zu lassen.
Ich bin in einer ländlichen Kultur in Italien aufgewachsen. Mit der „Modernisierung“ verschwanden Dialekt und Traditionen – und mit ihnen Gemeinschaft und Zusammenhalt. Es entstanden zunehmend anomische Zustände wie Kriminalität und Drogenkonsum. Wer soziale Kohäsion stärken will, muss Kulturen und Ökonomien wieder verwurzeln. Ich verließ 1989 die Dorfgemeinschaft, weil sie zwar solidarisch, aber auch geschlossen war. Es gibt Formen von Solidarität, die auf Kontrolle und Misstrauen beruhen. Nachhaltigkeit braucht hingegen Gemeinschaften, in denen sich Solidarität und Individualität gegenseitig befruchten. Dafür ist Vertrauen entscheidend. Wenn die Polykrise Ausdruck einer Vertrauenskrise ist, stellt sich die Frage, wo Vertrauen wieder entstehen kann – denn es ist Grundlage für Kooperation und Gemeinsinn. Vertrauen entsteht dort, wo Menschen persönlich interagieren – im Lokalen und in analogen Räumen. Während die Globalisierung auf anonymen Marktbeziehungen beruhte, sollte eine nachhaltige Transformation lokal verankert sein – und auf persönliche Kommunikation setzen. Auch neue, ko-kreative und nicht-kommerzielle Rituale können als Übungsfeld für Zusammenleben und gelebte Demokratie dienen. Ein Beispiel dafür ist der „Tag des guten Lebens“, der jahrelang in Köln, Wuppertal und Berlin stattgefunden hat.
Die weiteren Interviews finden sich unten.
Anmerkung der Redaktion: Das Interview wurde auf englisch geführt und von unserer Redaktion übersetzt.