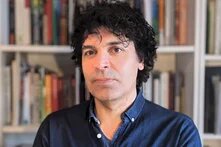Im ersten von vier Teilen des Interviews mit dem Soziologen Davide Brocchi erfahren wir mehr zu Hintergründen seines Buchs "By Disaster or by Design? Transformative Kulturpolitik". Die weiteren Interviewteile beschäftigen sich mit sozialer Resilienz, Kulturwandel und Transformation.

Was hat Sie dazu motiviert oder inspiriert, Ihr Buch "By Disaster or by Design? Transformative Kulturpolitik" zu schreiben? Wie sind Sie darauf gekommen, sich auf dieses sehr spezifische Thema zu konzentrieren?
Als ich 1969 geboren wurde, betrug die Weltbevölkerung 3,6 Milliarden Menschen. 1972 wurde der erste Bericht des Club of Rome „Die Grenzen des Wachstums“ veröffentlicht und die erste UN-Konferenz zur Umwelt des Menschen fand in Stockholm statt. Wir debattieren also schon seit mehr als 50 Jahren über Nachhaltigkeit – und trotzdem geht die tatsächliche Entwicklung in die entgegengesetzte Richtung. Das ist es, was ich in den Zeitungen im Januar 2025 lese: „Die Menschheit ist laut den Atomwissenschaftlern hinter der ‚Doomsday Clock‘ näher als je zuvor an einer Katastrophe: Es sind noch 89 Sekunden bis Mitternacht“.
Einige Soziologen definieren unsere Gesellschaft als „Wissensgesellschaft“. Heute wissen wir viel über die Probleme sowie über die möglichen Lösungen. Aber wir wissen nicht so genau, wie wir von den Problemen zu den Lösungen kommen – und das ist die Frage der Transformation. Nach der Finanzkrise von 2008 und dem Scheitern der UN-Klimakonferenz 2009 in Kopenhagen ist der Begriff der Transformation zum zentralen Leitmotiv der Nachhaltigkeitsdebatte avanciert – und bildet zugleich den roten Faden meines Buches
Um zu Lösungen zu gelangen, muss man bereit sein, die Probleme loszulassen. Wer Nachhaltigkeit will, muss sich von der Nicht-Nachhaltigkeit verabschieden: Das ist die wichtigste Voraussetzung für Transformation. In der Politikwissenschaft bedeutet Transformation nicht eine Korrektur oder Optimierung des Systems, sondern einen „Systemwechsel“ (Wolfgang Merkel). Heute stellt sich nicht mehr die Frage, ob wir einen radikalen Wandel wollen oder nicht: Wir befinden uns bereits mittendrin. Die einzige Frage ist, wie dieser Wandel stattfinden wird: by Disaster or by Design. Der Titel meines Buches ist beinahe ironisch, denn in den vergangenen Jahrzehnten mussten wir erkennen, dass selbst die physische Erfahrung von Krisen und Katastrophen nicht zwangsläufig zu einem Wandel by Design führt. Trotz der großen globalen Finanzkrise 2008 wird heute immer noch auf den Finanzmärkten spekuliert. Trotz des Klimawandels sind alle Parteien im deutschen Parlament für noch mehr Wachstum. Trotz der Krise der Demokratie bewegen sich die meisten Parteien nach rechts, statt die Demokratie zu stärken. Unsere Entwicklung führt uns in eine Sackgasse, aber die Gesellschaft drückt auf das Gaspedal. Wie ist das möglich? Eine erste Antwort auf diese Frage liegt in der „Macht der Kultur“. Kultur ist nicht nur positiv, sondern auch Teil des Problems. Solange wir in bestimmten mentalen Infrastrukturen gefangen bleiben – in einer „Culture as usual“ –, wird sich die Geschichte wiederholen. Eine nachhaltige Transformation erfordert keine bessere Ideologie, sondern vor allem individuelle und kollektive Lernfähigkeit – eine „kulturelle (R)evolution.
Eine zweite Antwort liegt in sozialer Ungleichheit und hegemonialen Strukturen. Sie behindern eine nachhaltige Transformation, etwa weil sie ermöglichen, die Kosten unserer Lebensweise zu verlagern – auf den Globalen Süden, auf künftige Generationen und auf die Natur. In meinem Buch versuche ich zu erklären, warum es keine Nachhaltigkeit ohne soziale Gerechtigkeit und eine Demokratisierung der Demokratie geben kann.
Welche Erfahrungen oder Einflüsse haben Sie in dieser Hinsicht geprägt?
Ich bin in den 1970er und 1980er Jahren in einem ländlichen Dorf in der Nähe von Rimini in Italien aufgewachsen. Meine Großeltern waren Bauern. Sie gingen nie zur Universität und kannten den Begriff Nachhaltigkeit nicht, aber ihre Landwirtschaft war weitaus nachhaltiger als die konventionelle Landwirtschaft von heute. Nachhaltigkeit bedeutet für mich also nicht nur Zukunft und Innovation: Ich habe sie auch in lokalen Kulturen und Traditionen erlebt, die durch das, was wir „Fortschritt“ nennen, zerstört wurden. Es war das Erkennen des „Kollateralschadens“ dieses Fortschritts, das mich dazu brachte, mich der Umweltbewegung in Italien anzuschließen. Als ich 14 Jahre alt war, gründeten einige Freunde und ich die erste Umweltvereinigung in der Gemeinde, in der wir lebten. In den 1980er Jahren war die italienische Umweltbewegung auch eine kulturelle Bewegung. Sie wurde von Wissenschaftlern, Philosophen und Intellektuellen wie Gregory Bateson, Ilya Prigogine, Barry Commoner und Hannah Arendt inspiriert. Diese Erfahrung hat mich sehr geprägt. Ich habe das Gefühl, dass das heute fehlt: Umwelt- und soziale Bewegungen als kulturelle Bewegungen.
Ihr Buch ist von drei Leitfragen geprägt. Was sind diese und können Sie uns kurz etwas darüber erzählen?
Das Ziel meines Buches ist es, die geistigen Horizonte der Debatte über Nachhaltigkeit, Transformation und Kultur zu erweitern, weil ein reduktives Verständnis dieser Begriffe eher dem Status quo dient als Veränderungen anzustoßen. Mein Buch behandelt drei zentrale Fragen:
1. Wie ist ein friedliches Zusammenleben in der Vielfalt auf einem begrenzten Planeten möglich? Durch freien Wettbewerb, Privatisierung und Wachstum wird uns es mit Sicherheit nicht gelingen. Nachhaltigkeit erfordert daher mehr Kooperation statt Wettbewerb, mehr Gemeinwesen statt Privatwesen. Vor allem die Dimension von Vertrauen und Misstrauen ist entscheidend für die Frage des Zusammenlebens. Wenn wir nicht länger auf Kosten anderer leben wollen, müssen wir unsere demokratische Agora so erweitern, dass diese anderen darin eine Stimme erhalten – der Globale Süden, künftige Generationen und die Natur.
2. Wie kann ein physisch und kognitiv begrenztes Wesen wie der Mensch Komplexität überhaupt handhaben? Im westlichen Kulturkreis wird Komplexität oft mit Chaos gleichgesetzt, Freiheit mit Anarchie. Das Fortschrittsprogramm der Moderne hat Komplexität daher auf eine künstliche Ordnung reduziert – und das Ergebnis dieses Prozesses war eine standardisierte, globalisierte Monokultur: in der Landwirtschaft, in der Wirtschaft, in der Architektur, im Denken. Latente Selektion zeigt sich jedoch auch im Kleinen, denn die meisten Menschen sind am liebsten „unter sich“, unter gleichen. Fremden gegenüber errichtet der Westen hingegen Grenzmauern. Wir leben in einer Monokultur, doch Monokulturen sind besonders anfällig für Krisen. Nachhaltigkeit erfordert deshalb andere Strategien im Umgang mit Komplexität, und der beste Weg ist: Vielfalt statt Monokultur – Komplexität durch Komplexität regieren.
3. Wie können wir eine Kultur verändern, in der wir selbst erzogen wurden? Wir handeln nicht zwangsläufig nach dem, was wir wissen, weil die Erziehung von Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten vor allem aus dem Unbewussten heraus wirkt. Eine äußere Transformation (Soziogenese) erfordert also zugleich eine innere Transformation (Psychogenese), wie Norbert Elias betonte. Als mentaler Bauplan der Gesellschaft kann jede Kultur materialisiert werden – etwa in Infrastrukturen, die unser Alltagsverhalten stark prägen. Ein nachhaltiges Leben innerhalb nichtnachhaltiger Infrastrukturen stellt eine enorme Herausforderung dar. Ist eine Kultur erst einmal materialisiert, wirkt sie über Generationen hinweg und lässt sich nur schwer verändern. Daraus ergibt sich die Frage, wie wir institutionalisierte und materialisierte Kultur wieder verflüssigen können. Dafür brauchen wir zum Beispiel Spielwiesen für Alternativen, neue Allianzen, Bewegungen...
Die weiteren Interviews finden sich unten.
Anmerkung der Redaktion: Das Interview wurde auf englisch geführt und von unserer Redaktion übersetzt.