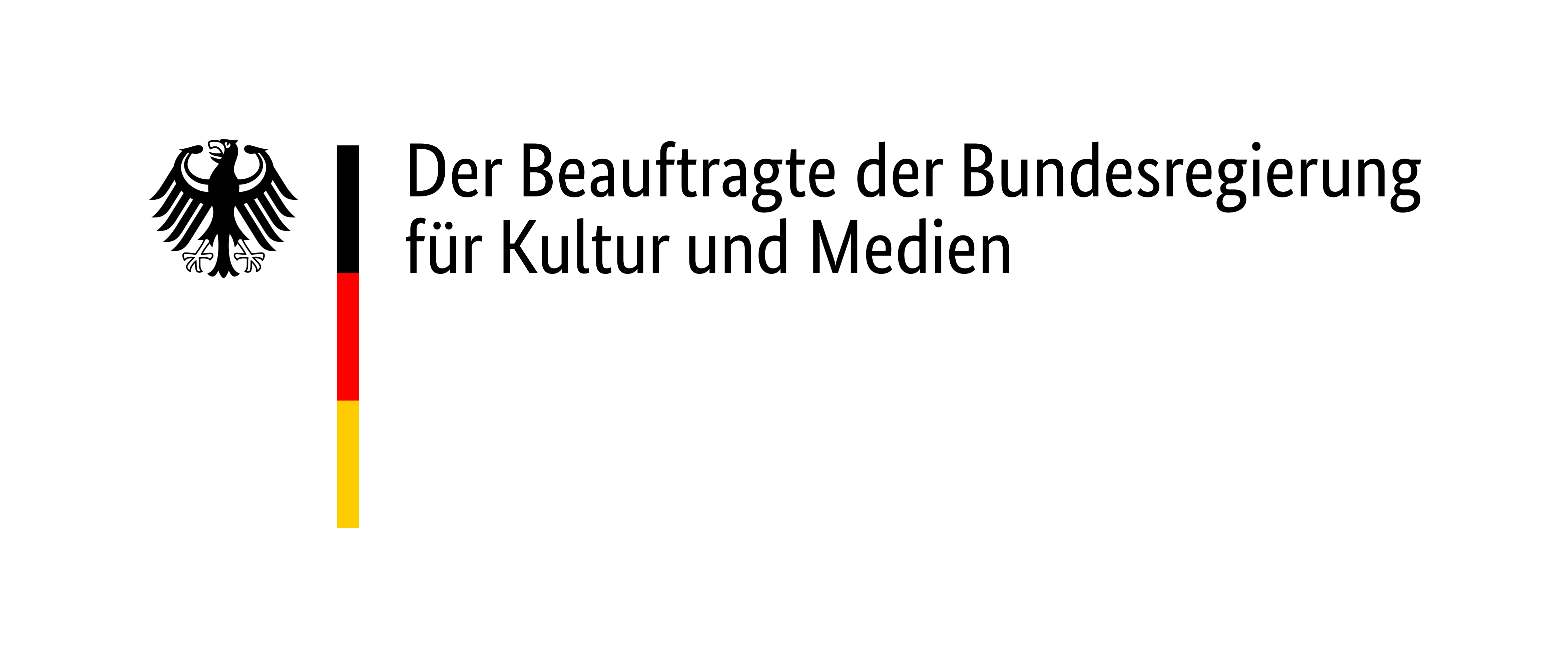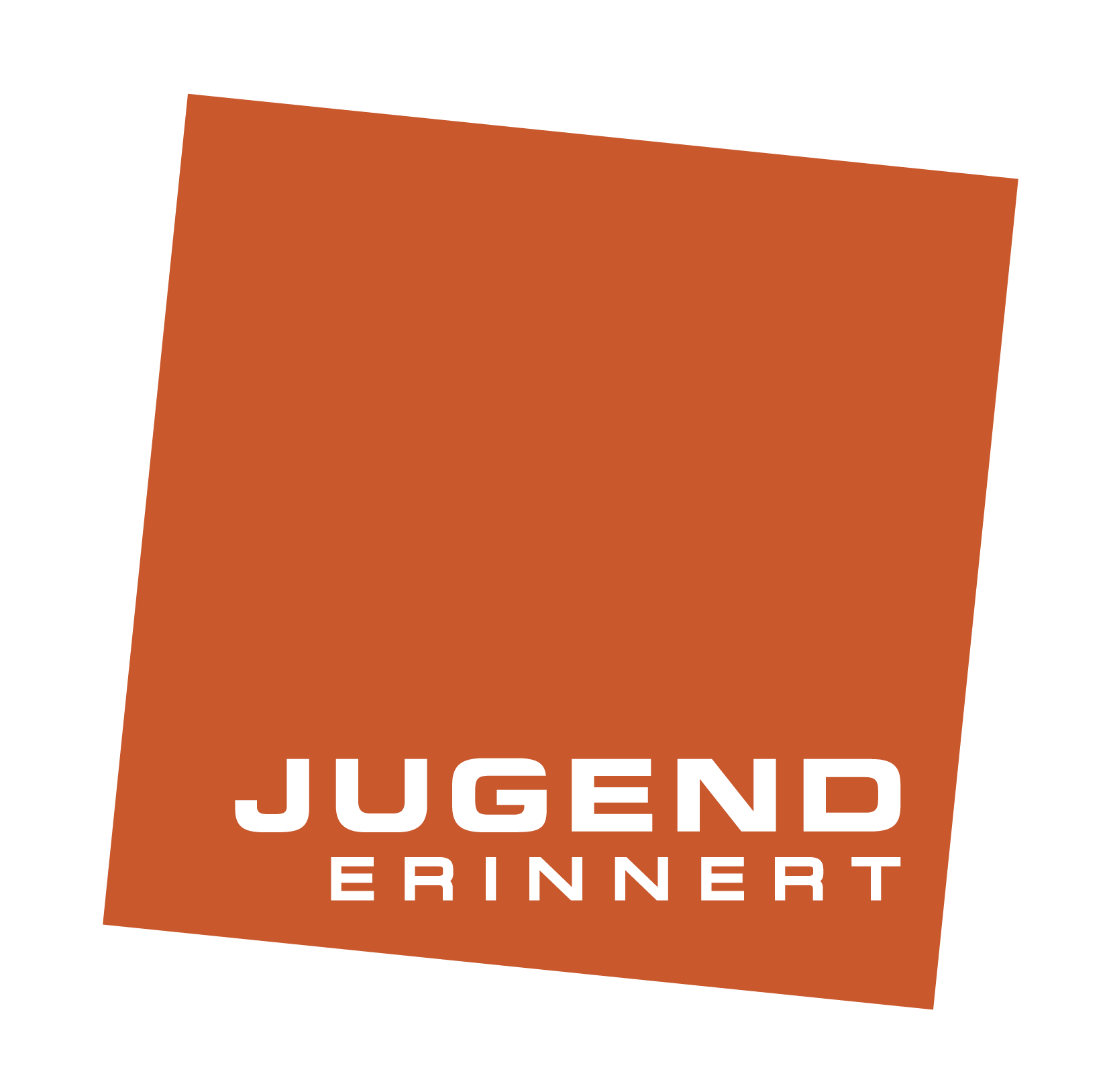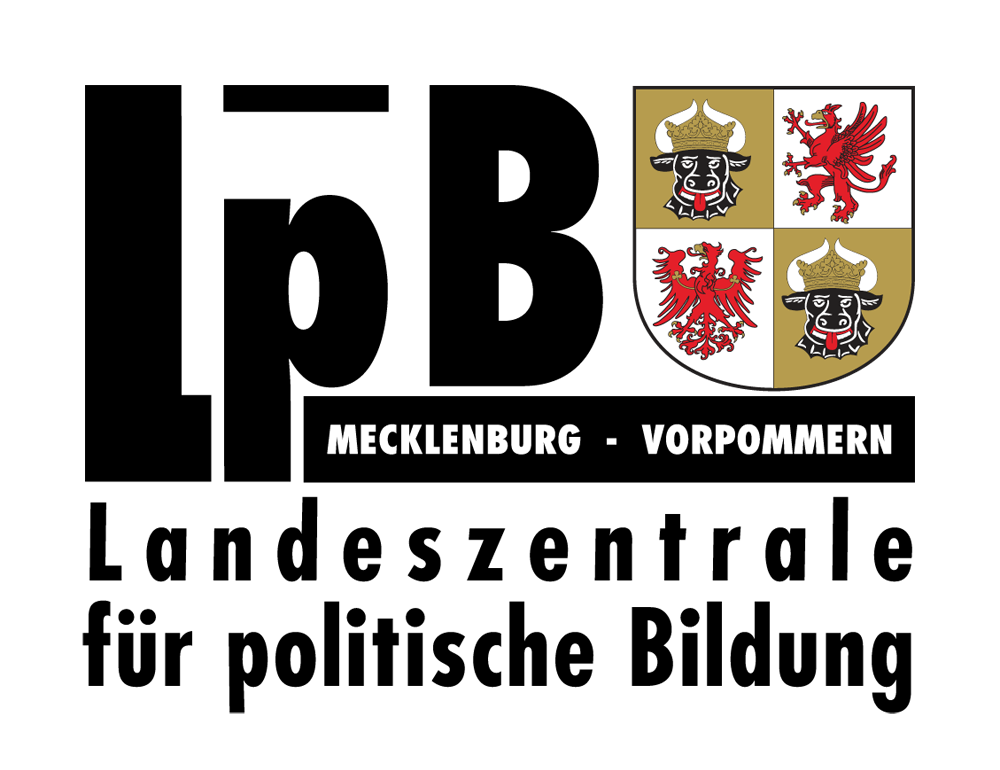Bruchlinien
Lebenswege zwischen Freiheit und Unterdrückung
Über Bruchlinien
„Bruchlinien“ eröffnet jungen Menschen mit Migrationsgeschichte neue und kreative Zugänge zu der deutschen Geschichte. Im Mittelpunkt stehen die Erfahrungen von Freiheit und Unterdrückung während der deutschen Teilung, der SED-Diktatur und nach der Wiedervereinigung bis heute. Die Teilnehmenden verknüpfen historische Ereignisse mit ihren eigenen Lebensrealitäten, etwa zu Migration, Menschenrechten oder im Umgang mit Rassismus. Dabei können Gemeinsamkeiten in den unterschiedlichen Erfahrungen festgestellt werden, die neue Perspektiven eröffnen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken.
Das Projekt richtet sich an Jugendliche, die heute in Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein leben. Sie erhalten die Möglichkeit, regionale und überregionale Bezüge zur deutsch-deutschen Geschichte zu entdecken, diese kritisch zu reflektieren und mit ihren eigenen Erfahrungen von Migration und Zugehörigkeit zu verbinden. So wird Geschichte nicht abstrakt vermittelt, sondern zu einer lebendigen Auseinandersetzung mit Fragen nach Freiheit, Ausgrenzung und Zusammenhalt in der Gegenwart.
In Rahmen von Exkursionen, Gesprächen mit Zeitzeug*innen und einer einwöchigen Autumn School begeben sich die Teilnehmenden auf regionale Spurensuche und setzen sich intensiv mit persönlichen Geschichten auseinander. In kreativen Workshops, zum Beispiel zu Fotografie oder kreativem Schreiben, entwickeln sie eigene Zugänge zu diesen Themen. Sie setzen historische Erfahrungen nicht nur in Bezug zu aktuellen gesellschaftlichen Fragen, sondern auch zu ihrer eigenen Familien- und Migrationsgeschichte.
Die Ergebnisse dieser Prozesse werden in einer Wanderausstellung festgehalten. Neben der physischen Ausstellung wird auch eine digitale Version entwickelt, die langfristig für Schulen und Interessierte zugänglich sein wird. Gemeinsam mit verschiedenen Partner*innen aus Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern trägt das Projekt dazu bei, eine plurale Erinnerungskultur zu fördern, die unterschiedliche Perspektiven sichtbar macht und den gesellschaftlichen Dialog stärkt.
Du hast Lust, am Projekt teilzunehmen oder Menschen in deinem Umfeld darauf aufmerksam zu machen? Melde dich bei uns, wir freuen uns auf den Austausch!
Plurale Erinnerungskultur bedeutet, dass die Art und Weise, wie wir uns an Geschichte erinnern und über sie sprechen, nicht nur eine einzige Sichtweise zulässt, sondern verschiedene Perspektiven und Erfahrungen einbezieht. Oft wird Erinnerung von der Dominanzgesellschaft geprägt: bestimmte Ereignisse, Erzählungen oder „nationale Mythen“ stehen im Vordergrund, während andere Erfahrungen (z. B. von Minderheiten, Migrant*innen oder marginalisierten Gruppen) ausgeblendet bleiben. Eine plurale Erinnerungskultur versucht, diese Lücken zu schließen und mehrstimmige Erzählungen sichtbar zu machen.
Zum Dossier Erinnerungskultur